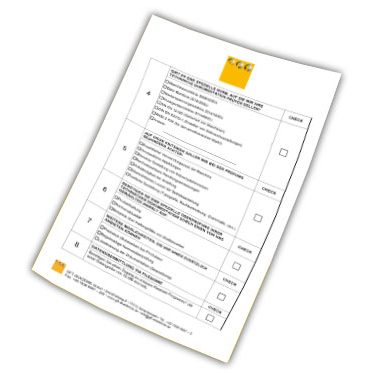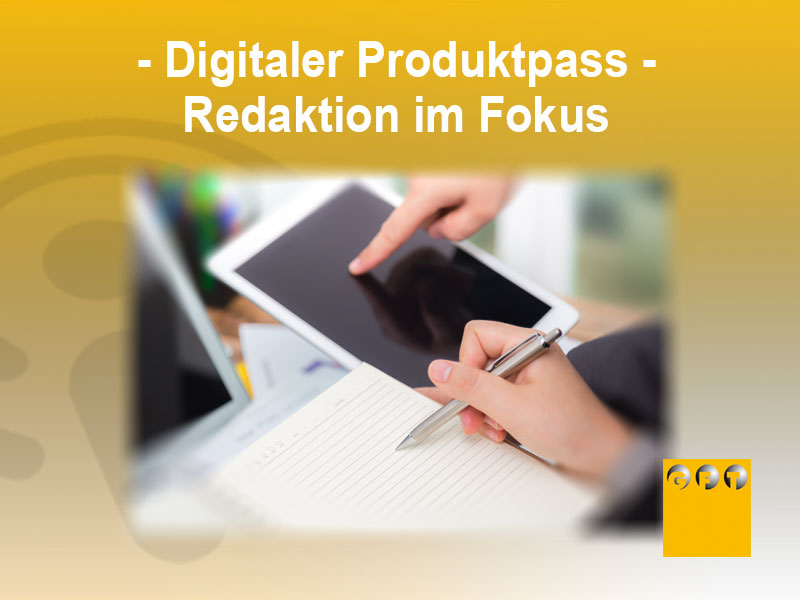In dieser Folge werfen wir einen Blick auf das neue Jahr 2026 – ein Jahr,…
Leben#06 Kostenklartext Teil 3b – Sondermaschinen: Meilensteine & Abnahme in der Praxis: Risiken, Checklisten, Fotoprotokoll

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Podigee. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenHeute kommen wir zu Teil 3b unserer Reihe „Kosten‑Nutzen in der Technischen Dokumentation“. In Teil 1 haben wir Kosten und Nutzen transparent gemacht, in Teil 2 das Serienprodukt durchgerechnet. In Teil 3a haben wir uns angeschaut, wie die Kosten der technischen Dokumentation für Sondermaschinen entstehen. Heute schauen wir uns an, wie man diese Kosten reduzieren und in Griff bekommen kann.
Ein paar wichtige Hinweise vorab: Alles, was wir heute an Zahlen nennen, sind wieder Orientierungswerte. Produkte unterscheiden sich. Komplexität unterscheidet sich. Darum legen wir Rechenwege offen, damit Sie die Größenordnung selbst übertragen können.
Alle Tagessätze beziehen sich dabei auf durchschnittliche Werte von externen Dienstleister und nicht auf interne Abteilungen. Falls Sie an einer Vergleichsrechnung zwischen Interner Erstellung und Outsourcing interessiert sein sollten, lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen. Dann machen wir dazu einen Podcast.
Und zu guter Letzt: Ich spreche heute von einer guten, hochwertigen Dokumentation, die von einem professionellen Dienstleister erstellt wird. Und zwar im Zuge eines Erstprojektes für den Start einer Zusammenarbeit mit dem Anlagenhersteller. Denn dieser Podcast soll die Frage beantworten, warum die Kosten zu diesem Zeitpunkt sind, wie sie sind. Kosten nach einer längeren Zusammenarbeit lasse ich bewusst außen vor, da deren Kalkulation stark abhängig von Arbeitsweise und Datenlage ist. Ein solches Beispiel zu konstruieren ist sehr komplex, eventuell könnte das jedoch eine Folge für die Zukunft werden.
Auch möchte nicht die Arbeit von Kollegen und Kolleginne schlecht reden. Auch angestellte Redakteure können tolle Dokumentationen erstellen und leider gibt es auf der anderen Seite auch Dienstleister die schlechte Dokumente liefern. Die Ausgangssituation dieser Folge soll jedoch die Situation beschreiben, die wir häufig vorfinden. Unser Anlagenhersteller ist somit ein Klein- bis Mittelständisches Unternehmen ohne eigenen technischen Redakteur, bei dem die Technsiche Dokumentation bisher eher stiefmütterlich behandelt wurde.
So, genug mit dem Vorgeplänkel. Wie bekommen wir die Probleme in den Griff?
Meilensteine & messbare Ergebnisse
Wie gelingt es uns , eine vollständige Anleitung rechtzeitig für die Abnahme fertigzustellen, um Verzögerungen und Rückbehalte zu verhindern? Am besten funktioniert das ganze mit Meilensteinen, klaren Verantwortlichkeiten und gut geplanten Zeiträumen.
Denn nicht nur die Zeit, die der Dienstleister für die Erstellung der Dokumentation benötigt sollte berücksichtigt werden, sondern auch das Projektmanagement auf Seiten des Anlagenherstellers. Also die Abstimmung zwischen Dienstleister und Anlagenhersteller, die für den Informationsfluss benötigte Zeit. Auch diese Kennzahl wird gerne übersehen. Was kommt also dazu?
- Projektstart oder Kick-Off-Meeting (½ Tag): Hier werden die Grenzen der Maschine, Betriebsarten, Zielmärkte, Sprachen, Abnahmekriterien definiert. Das Ergebnis: Startprotokoll + Terminplan.
- Normativer Umfang (2–3 Tage): Erstellung einer Normenliste mit Prioritäten, Sichtung des Lastenheftes und Identifikation der Sicherheitsfunktionen und Gefahrenbereiche. Das Ergebnis: Eine Normenmatrix die zur fertigen Normen- und Richtlinienrecherche verarbeitet werden kann.
- RB‑Workshop (1 Tag): Ermittlung der Gefährdungen/ Festlegen der Schutzmaßnahmen, ggf. SISTEMA‑ Ergebnis: Ein RB‑Protokoll das zur fertigen Risikobeurteilung verarbeitet werden kann.
- Vor‑Ort‑Abgleich/Bildproduktion (1–2 Tage): Fotos/Render, Kennzeichnungspunkte. Ergebnis: Basis für die Erstellung der Abbildungen für die Technische Dokumentation.
- Prüfung des Entwurfs der Anleitung (3–5 Tage): Prüfung der Struktur, der Skeletttexte, des Warnsystem, der Bilder, etc. von weiteren Projektverantwortlichen auf Corporate Identity und Vollständigkeit, um „Änderungen in letzter Minute“ abzudecken. Sollten Anforderungen an Struktur und Layout seitens Endkunden vorhanden sein, können diese hier auch mit bearbeitet werden Ergebnis: Korrektur‑PDF die zur finalen Anleitung führt.
- Reviews (1–2 Tage): Fachabnahme (durch Entwicklung, Service, oder andere Abteilungen), Ergebnis: Korrekturlauf oder Freigabe.
- CE‑Unterlagen (2–3 Tage): Technische Doku, Konformitätserklärung, Kennzeichnung werden an den Anlagenhersteller zur Prüfung und Freigabe übermittelt. Ergebnis: Korrekturlauf oder Freigabe.
- Begleitung während Abnahme (optional, 0,5–1 Tag): CE-Beauftragter ist bei der Abnahme durch den Endkunden dabei und kann Fragen zur Dokumentation beantworten.
All diese Punkte zusammen ergeben einen zusätzlichen Zeitraum von 11 bis 17 Tagen, die zusätzlich zur Bearbeitungszeit dazu gerechnet werden müssen. Sprich für die Dokumentation für eine Sondermaschine sollte in Summe für Anleitung, CE-Kennzeichnung und Projektmanagement eine Gesamtzeit von 34 bis 54 Arbeitstagen gerechnet werden. Mit der Dokumentation sollte also spätestens 2-3 Monate vor dem Abnahmetermin begonnen werden. Selbstverständlich abhängig von der Komplexität der Anlage.
Werden diese Angaben jedoch auf das jeweilige Projekt korrekt umgerechnet, entsteht ein belastbarer Zeitplan für die Projektierung der Sondermaschine. Somit kann die Dokumentation zur Abnahme final fertiggestellt werden. Aber das ist in der Praxis häufig leider selten der Fall, da die Dokumentation zu spät ins Boot geholt wird.
Beschleunigung der Abnahme in der Praxis durch erweiterte Dokumentation
Die Dokumentation kann aber noch mehr für eine Sondermaschine tun. Denn wenn man über den Tellerrand hinausschaut, kann man aus einer guten Dokumentation noch mehr herausholen. Das folgende gilt nicht nur bei Sondermaschinen, sondern kann auf alle Arten von Produkten angewendet werden. Jedoch hat es bei Sondermaschinen häufig eine größere Wirkung, da hier aufgrund der Komplexität andere Zeitfaktoren gelten.
Ist eine Dokumentation gut aufgebaut, strukturiert und in einem Redaktionssystem erstellt worden, lassen sich daraus auch weitere Dokumente ableiten. Diese können die Abnahme der Anlage beschleunigen und auch dort Zeit sparen.
Denn der Kunde hat im Lastenheft Leistungsangaben und Prüfwerte dokumentiert, die bei der Abnahme überprüft werden. Durch kompakte Zusatzdokumente, abgeleitet aus der Anleitung über das Redaktionssystem können diese schneller überprüft werden.
Ein Werkzeugwechsel soll innerhalb einer gewissen Zeit durchgeführt werden können? Eine Kurzanleitung für den Werkzeugwechsel sammelt alle relevanten Informationen kompakt für die Abnahme. Anhand dieser können die geforderten Zeiten überprüft werden.
Für die Schulung und Inbetriebnahme der Maschine durch neue Mitarbeiter soll es Informationen geben? Auch diese können über das Redaktionssystem aus der eigentlichen Anleitung abgeleitet werden. Und das besondere daran? Es gibt Korrekturwünsche bei der Abnahme, diese werden durch die Wiederverwendung im Redaktionssystem nicht nur in der Kurzanleitung vorgenommen, sondern auch automatisch in den anderen jeweiligen Dokumenten, wie der vollständigen Anleitung.
Das Ganze kann sich schnell rechnen. Stellen Sie sich vor, in der Abnahme werden 2 Personen von Ihrem Unternehmen benötigt. Ein Servicetechniker und ein Elektriker. Durch ein sauberes, kompaktes Kurzdokument für die Inbetriebnahme, abgeleitet aus der vollständigen Anleitung, reduziert sich dieser Prozess um einen halben Tag. Weil die Informationen klar und vollständig vorliegen. Ein halber Tag bei 2 Personen mit einem internen Stundensatz von 60 EUR sind 960 EUR.
Und das ist nur ein Beispiel, theoretisch können viele separate Dokumente abgeleitet werden. Egal ob Kurzanleitungen für Inbetriebnahme, Rüstarbeiten, Wartungsarbeiten oder Checklisten. Die Basis dafür bildet jedoch immer eine klare und saubere Dokumentation, im Optimalfall aus einem Redaktionssystem.
Kommen wir nun noch zu den typischen Stolperfallen und Risiken im Projektalltag.
Muster-Betriebsanleitungen, Vorlagen für Warnhinweise, sowie Checklisten, E-Books und vieles mehr. Besuchen Sie jetzt unseren Online-Shop für die Technische Dokumentation!
Projektrisiken & Gegenmaßnahmen
Typischerweise gibt es für Sondermaschinen und deren Technsiche Dokumentation 4 Arten von Projektrisiken, die wir nun einzeln betrachten und erläutern welche Gegenmaßnahmen getroffen werden können.
Risiko 1 „Änderungen in letzter Minute“
Unsere erstes Projektrisiko ist das häufigste. Durch Kundenwünsche oder falsch interpretierte Lastenhefte kommt es zu späten Änderungen an Konstruktion oder Software. So spät, dass es schwer wird, diese rechtzeitig vor der Abnahme umzusetzen.
Die Gegenmaßnahme ist hier das Projektmanagement des Projektverantwortlichen. Er muss Sperrfristen für kritische und unkritische Anpassungen festlegen. Die technische Redaktion muss mit einer Art Änderungsnachverfolgung arbeiten und Bausteine und Module möglichst passend gestalten. So bleibt auch der Umfang einer nachfolgenden Übersetzung möglichst gering. Für diese Situation zahlt sich ein erfahrener Technischer Redakteur in Kombination mit einem Redaktionssystem aus.
Risiko 2 Unklares Lastenheft und damit unklare Abnahmekriterien
Das zweite Projektrisiko kommt ebenfalls häufig vor. Meist tritt es in Kombination mit größeren Ausschreibungen auf, die an viele verschiedene Maschinenbauer versendet werden. Der Endkunde möchte eine Art „Eierlegende Wollmichsau“, eine Anlage die alles kann.
Das führt häufig zu einem Lastenheft, dass voll mit Abnahmekriterien steckt. Dass diese sich teilweise widersprechen oder gegenseitig ausschließen, kommt auch durchaus vor. Oder die Lieferkette des Projektes ist in so viele Teilnehmer aufgesplittet, dass am Ende niemand richtig weiß, was er eigentlich liefern muss. Verkompliziert kann das ganze dann noch werden, wenn Geheimhaltung eine Rolle spielt. Auch das habe ich bereits erlebt.
Ich war damals der Ansprechpartner für die CE-Kennzeichnung. Das damalige Projekt bestand auch aus vielen Teilschritten, wir waren beim Hersteller für das Grundgerüst als Partner angegliedert. Im Lastenheft stand, dass das Grundgerüst für ATEX-Konform ausgelegt sein soll.
Es fehlten aber die Rahmendaten, also die Art der explosionsfähigen Atmosphäre, die Zone, die Gerätegruppe und die Temperaturklasse. Wir fragten also nach. Zunächst wurden die Informationen aufgrund von Geheimhaltung nicht preisgegeben. Aber die ATEX Konformität sollten wir trotzdem erklären.
Auf unser Drängen hin und den Hinweis, dass dies weder legal noch möglich ist, ging es in die Klärung über die gesamte Lieferkette bis zum Endkunden. Diese Klärung kostete 4 Wochen Zeit, was das gesamte Projekt verzögerte. Hätten wir dies jedoch nicht getan, hätte es das gesamte Projekt schädigen können. Wären ungeeignete Materialien oder Komponenten verbaut worden, hätte es im schlimmstenfalls sogar zu einem Unfall führen können.
Die Lösung für das Risiko? Das Lastenheft zu Beginn gründlich lesen und überprüfen. Fehler und Änderungen dokumentieren und klären. Mit Unterschrift am Besten seitens Kunde dokumentieren. Damit am Ende bei der Abnahme nicht doch plötzlich die Anforderung wieder im Raum steht und nicht erfüllt werden kann.
Risiko 3 Terminologie Chaos
Unser drittes Projektrisiko betrifft die Technische Dokumentation an sich bzw. deren Sprache. Damit meine ich in erster Linie nicht Übersetzungsfehler, sondern ein Chaos, dass bereits bei der Ausgangssprache entstehen kann. Ich spreche von Terminologie, insbesondere im Hinblick auf HMI-Oberflächen, Ersatzteillisten, Service-Unterlagen und die eigentliche Anleitung.
Wenn beispielsweise aus dem Transportband ein:
- Förderband
- Bandförderer
- Produktförderer
- Oder sonst ein ähnlicher Begriff wird.
Hier hat der Redakteur oder der jeweilige Verantwortliche wie zum Beispiel der Steuerungstechniker Fehler gemacht und man hat nun einen Blumenstrauß an Begriffen für dasselbe Teil oder dieselbe Funktion.
Die Folgen können ganz unterschiedlich sein. Entweder sind Anleitungen irreführend und führen zu Fehlanweisungen, es werden falsche Ersatzteile bestellt, es werden falsche Teile ausgebaut, usw. Alles Dinge, die Geld kosten können. Und wenn es schlecht läuft und der schlimmste Fall eintritt, werden Personen verletzt.
Weiter möchte ich auf dieses Thema hier nicht eingehen. Falls Sie hier weitere Informationen suchen, empfehle ich Ihnen die Folge „VS004 Terminologie in der Technischen Redaktion“ meine Kollegen Volker Rummel.
Risikobündel 4 – Fotolücken: fehlende Bilder, falscher Zeitpunkt, falscher Stand
Kommen wir zum 4. Risiko. Fehlende Fotos und Bilder. Was ist das Risiko? Die benötigten Fotos fehlen, sind vom falschen Bauzustand oder zeigen nicht die relevanten Details (z. B. Schutzeinrichtungen, Verriegelungen, Typenschilder, Warnkennzeichen). Besonders kritisch wird es, wenn bei der Abnahme beim Kunden keine Fotos gemacht wurden und später ein Unfall nach dem Entfernen einer Schutzeinrichtung passiert: Dann ist unklar, ob die Schutzeinrichtung zum Abnahmezeitpunkt montiert und funktionsfähig war.
Wie kommt es zu dieser Situation?
- Die Abnahme wird ohne Fotoprotokoll und ohne prüfbare Checkliste durchgeführt.
- Der Fototermin wird am falschen Zeitpunkt gemacht (z. B. vor finalem Aufbau oder nach Verkleidung).
- Die Zuständigkeit ist ungeklärt (wer fotografiert, wer prüft, wer legt ab).
- Keine Dateibenennung/Version, Bilder sind später nicht eindeutig zuzuordnen.
Die Folgen in der Praxis:
Es werden Nachfotografieren vor Ort benötigt, Freigaben verschieben sich, es gibt Streit über den Ausgangszustand, dadurch mögliche Rückbehalte, zusätzlichen Mehraufwand in Redaktion/Übersetzung und im schlimmsten Fall Unterbrechungen im Betrieb um neue Bilder zu erstellen.
Wie verhindern wir das?
- Frühzeitige Planung des Fotoprotokolls für die Abnahme
Definieren Sie eine verbindliche Motivliste (Bildraster) für die Abnahme:- Alle Schutzeinrichtungen montiert, verschraubt/verriegelt (außen/innen, Detail).
- Verriegelungsprüfung dokumentiert (z. B. Haube offen → kein automatischer Anlauf).
- Typenschild, Warn- und Gebotszeichen, Not-Halt und Bedienelemente.
- Anschlussstellen (elektrisch/medien), Wartungspunkte.
→ Fotos mit Datum/Uhrzeit, Projekt-/Maschinen-ID.
- Übergabeprotokoll mit Fotostrecke als Anlage
Checkliste mit ankreuzbaren Punkten: „Schutzeinrichtung montiert“, „Verriegelung geprüft“, „Hinweisschilder vorhanden“. Unterschrift beider Seiten. Die Fotostrecke ist Anlage zum Protokoll. - Sicht-/Funktionsprüfung nachvollziehbar machen
Kurztest mit Prüfschritten (z. B. „Haube öffnen → Antrieb steht, Quittierung erforderlich“). Ergebnisse im Protokoll abhaken. In der Anleitung: HInweis auf diese Prüfungen und die Grenzen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. - Manipulation erschweren, Zustand kenntlich machen
Sicherungsplomben/Lacksiegel an Demontagepunkten (sofern sinnvoll), Warnhinweise „Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt werden“. In der Anleitung: Wartungskapitel mit klarer Freigabe-Prozedur nach dem Öffnen/Wechseln. - Dateibenennung und Ablage
Einheitliches Schema, z. B. PROJ-1234_Übergabe_2025-09-15_Schutzhaube_vorne_montiert.jpg. Ordner nach Bauzustand (offen/final) und Kapitelbezug (Betrieb/Wartung/Schutz).
Messbare Ergebnisse
- Beweisfunktion am Tag der Abnahme: Fotos + Unterschrift belegen den montierten/funktionsfähigen Zustand.
- 0 zusätzliche Vor-Ort-Termine für Nachfotografie zur Abnahme.
- Mindestens eine Schleife weniger in Redaktion/Übersetzung, weil der endgültige Zustand vorliegt.
Wir merken: „Abnahmefotos und eine Checkliste machen den Ausgangszustand prüfbar – und beenden Diskussionen, bevor sie entstehen.“
Zusammenfassung & Ausblick
Heute haben wir gezeigt: Bei Sondermaschinen entscheidet die Anleitung mit über Abnahme, Rückbehalte und damit Ihre Liquidität. Mit klaren Meilensteinen, belastbaren Ergebnissen und abgeleiteten Kurzunterlagen wird die Abnahme prüfbar und schneller. Risiken wie „Änderungen in letzter Minute“, unklare Lastenhefte, Terminologie-Wildwuchs oder Fotolücken verlieren ihren Schrecken, wenn Zuständigkeiten, Sperrfristen und Fotoprotokoll feststehen.
Sie wollen die Übersicht behalten? Dann nutzen Sie unsere kostenlosen Checklisten für die Technische Dokumentation und zur Überprüfung Ihrer Betriebsanleitungen!