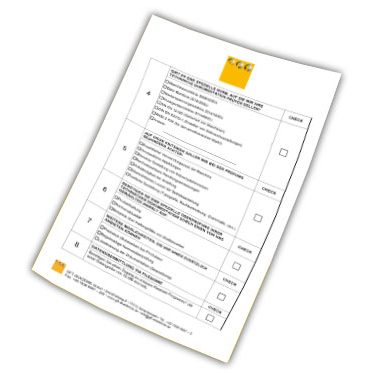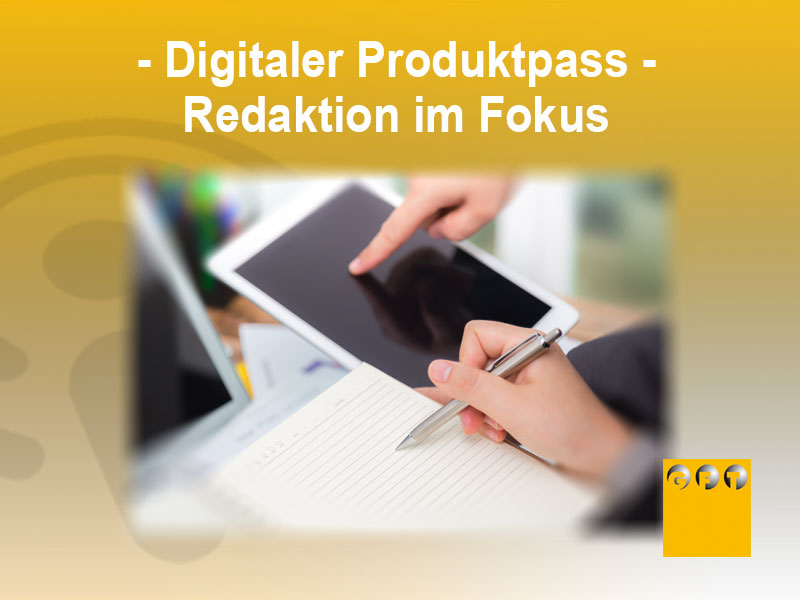In dieser Folge werfen wir einen Blick auf das neue Jahr 2026 – ein Jahr,…
DD# 017 Digitaler Produktpass

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Podigee. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenStellen Sie sich vor: Jede Maschine und Anlage erhält schon bald ihren eigenen digitalen Ausweis. Der digitale Produktpass verknüpft dann alle relevanten Daten – von Material über Reparaturanleitungen bis hin zu Recyclingtipps – direkt am Bauteil. Wir tauchen ein in die EU-Ökodesign-Verordnung und klären, warum die Technische Redaktion im Maschinenbau dabei eine Schlüsselrolle spielt.
Digitaler Produktpass im Maschinenbau
Der Digitale Produktpass (DPP) ist ein digitales „Ausweisdokument“ für physische Produkte, das entlang ihres gesamten Lebenszyklus zentrale Daten bündelt. Er wurde im Rahmen des EU-Green Deal und der neuen Ökodesign-Verordnung eingeführt. Laut Artikel 2 dieser Verordnung ist der DPP „ein produktspezifischer Datensatz, der die … in den Delegierten Rechtsakten genannten Informationen enthält und … elektronisch zugänglich ist“. Ziel des DDP ist es, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu fördern: Verbraucher, Unternehmen und Behörden sollen z.B. CO₂-Fußabdruck, Reparierbarkeit oder Materialzusammensetzung eines Produkts leicht abrufen können.
Für erste Produktgruppen gelten daher schon bald Pflichttermine: So sieht die neue EU-Batterieverordnung ab Februar 2027 einen verpflichtenden digitalen Batteriepass vor, der den Lebenszyklus von EV- und Industriebatterien lückenlos dokumentiert. Auch Textilien, Elektronik und Verpackungen sollen bis etwa 2030 einen digitalen Produktpass erhalten. Maschinen- und Anlagenbau sollen später betroffen sein, da die Delegierten Rechtsakte schrittweise für alle Sektoren erarbeitet werden.
Pflichten und Herausforderungen für Maschinenbauer
Maschinenbauer müssen sich frühzeitig auf neue Berichtspflichten und Daten-Management einstellen. Viele Daten, die der DPP verlangt, decken Themen ab, für die Unternehmen ab einer gewissen Größe heute schon Informationen zusammentragen – etwa für Lieferketten- oder Ökodesign-Berichte. Dazu gehören z.B. Angaben zu Haltbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Reparierbarkeit und generell Transparenz über den kompletten Produktlebenszyklus – etwa Umweltkennzahlen und Informationen zur späteren Demontage und zum Recycling.
Ökodesign-Anforderungen verlangen oft, dass Maschinen reparierbar ausgelegt werden. Konkret heißt das: Konstruktion und Fertigung müssen ggf. so angepasst werden, dass Austauschmodule oder Reparaturkits eingesetzt werden können. Gleichzeitig müssen Firmen die Reparaturfähigkeit dokumentieren – etwa in Form von Reparaturanleitungen oder Wartungshandbüchern – und Mitarbeiter darin schulen. Wer Maschinen mit elektrischen Antrieben oder Energieverbrauch in Verkehr bringt, muss zudem ab 2027 die neue Maschinenverordnung (EU 2023/1230) beachten: Sie ersetzt die alte Richtlinie und ermöglicht künftig u.a. die vollständig digitale Betriebsanleitung.
Insgesamt erfordert der DPP also ein unternehmensweites Konzept: Verantwortliche müssen definieren, welche Abteilungen welche Daten liefern (Entwicklung, Einkauf, Fertigung, QM, techn. Dokumentation, Service u.v.m.) und es müssen IT-Systeme eingerichtet werden, die Produktdaten erfassen und verknüpfen. Häufig genutzt werden Product-Information-Management- (PIM) oder Product-Lifecycle-Management-Systeme (PLM) sowie ERP- oder Stammdatensysteme.
Relevante Produktdaten im DPP
Ein Digitaler Produktpass enthält Produktinformationen, die heute zum Teil schon aus Anleitungen, Katalogen oder Verpackungen bekannt sind, aber jetzt systematisch vernetzt werden. Wichtige Datenpunkte sind zum Beispiel: Produktname, Hersteller und Herstellungsort; verwendete Materialien (inkl. Chemikalien und Allergene); Recyclingmöglichkeiten und Umweltkennzahlen; Angaben zu Garantie, Instandhaltung und Konformität (CE-Kennzeichnung, Prüfberichte). Darüber hinaus werden zunehmend ökologische und soziale Indikatoren abgefragt – etwa Arbeitsbedingungen in der Zulieferkette oder Energieverbrauch in der Produktion.
Wichtige Normen und Regularien
Die neue Ökodesign- Verordnung EU 2024/1781 verpflichtet Hersteller künftig, Daten im DPP bereitzustellen. In begleitenden Delegierten Rechtsakten wird festgelegt, welche Daten für welche Produkte erforderlich sind. Für Maschinenbauer relevant ist auch die neue Maschinenverordnung (EU 2023/1230), die ab Januar 2027 gilt und erstmals eine rein rechtsverbindliche Verordnung statt Richtlinie darstellt. Sie modernisiert das Produktsicherheitsrecht (z.B. digitale Anleitung erlaubt) und wird parallel zur Ökodesign-Verordnung zu beachten sein.
Auf nationaler und internationaler Ebene gibt es bereits Ansatzpunkte. Die DIN 77005 („Lebenslaufakten für technische Anlagen“) etwa definiert, welche Dokumente und Daten für Verwertung und Recycling technischer Produkte zu sammeln sind – ein gutes Fundament für den DPP. International gibt es Normen wie die IEC/IEEE 82079-1 für die Anleitungserstellung oder die VDI 2770 für Produkthinweise.
Muster-Betriebsanleitungen, Vorlagen für Warnhinweise, sowie Checklisten, E-Books und vieles mehr. Besuchen Sie jetzt unseren Online-Shop für die Technische Dokumentation!
Auswirkungen auf die Technische Redaktion
Technische Redakteure stehen im Zentrum der DPP-Umsetzung, denn ein großer Teil der geforderten Daten stammt aus der Dokumentation. Im Anhang III der Ökodesign-Verordnung werden z.B. explizit Benutzerhandbücher, Gebrauchsanleitungen, Warn- oder Sicherheitshinweise aufgeführt, die im DPP enthalten sein müssen. Zudem fordern viele Vorgaben, dass Reparatur- oder Wartungsanleitungen – samt Ersatzteillisten – digital verfügbar sind. Das bedeutet: Inhalte wie technische Zeichnungen, Komponentenlisten, Schmierpläne oder Explosionszeichnungen, die bislang nur im PDF vorlagen, müssen zukünftig systematisch auf Datenebene vorliegen.
Praxisnah heißt das: Redaktionen müssen ihre Prozesse überdenken und enger mit Entwicklung, Produktion und Service verzahnen. Statt am Ende des Entwicklungsprozesses ein statisches Handbuch zu „drucken“, sammelt die Redaktion schon während der Konstruktion Inhalte in strukturierter Form. Sie ergänzt Anleitungen um Metadaten, damit diese automatisiert in den DPP einfließen können. Normale PDF-Downloads reichen künftig nicht mehr aus. Vielmehr geht es um offene, XML-basierte Formate, die über digitale Kanäle vernetzt abgerufen werden können.
Aus der Sicht der Redaktion bedeutet das vor allem: alte Gewohnheiten ablegen. Die ohnehin bestehende Tendenz zu „Daten statt Buchseiten“ wird durch den DPP massiv verstärkt. Einige konkrete Folgen:
- Neue Daten liefern: Inhalte aus Bedienungsanleitungen (z.B. Sicherheitshinweise), Produktdatenblättern oder Zulassungsdaten müssen um Nachhaltigkeits- und Lebenszyklus-Infos ergänzt werden.
- Verantwortlichkeiten definieren: Wer liefert welche Daten? Dabei gilt es, bestehende Redaktionsprozesse anzupassen: Etwa können Content-Management-Systeme (CMS) oder Content-Delivery-Portale (CDP) so konfiguriert werden, dass Daten per API direkt in die DPP-Datenbank fließen.
- Tool-Anforderungen: Die Wahl der richtigen Werkzeuge ist entscheidend. Manche Anbieter werben bereits mit DPP-Funktionalitäten in PIM/ERP-Systemen. Ob sich spezialisierte DPP-Plattformen oder klassische Redaktionssysteme eignen, muss sich im konkreten Anwendungsfall zeigen.
- Schulungen und Zusammenarbeit: Für die Redaktion heißt das, neue Kompetenzen aufzubauen. Wissen über Datenmodellierung, Datenbanken und Schnittstellen wird wichtiger. Technische Redakteure müssen zudem eng mit Konstrukteuren, Einkäufern und IT-Spezialisten zusammenarbeiten, um die Daten entlang der Wertschöpfungskette zu bündeln
Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Technische Redaktion kann ich Ihnen auch noch eine unserer alten Podcast Episoden empfehlen. Dort haben wir uns bereits mit der Nachhaltigkeit von Produkten und die Auswirkungen auf die technische Redaktion beschäftigt.
Typische Probleme und Stolperfallen
Die Einführung des Digitalen Produktpasses birgt einige Fallstricke. Häufig treten Probleme folgender Art auf:
- Datenverfügbarkeit: Wie die Analyse zeigt, liegen benötigte Informationen oft verteilt in unterschiedlichen Systemen (ERP, PDM, CRM, Excel-Listen). Dabei fehlen nicht selten eindeutige Identifikatoren oder Datensatzlücken. Es kann sehr mühsam sein, z.B. Materialzusammensetzung oder Recyclingdaten zu beschaffen, wenn diese bisher nur auf Papierdokumenten standen.
- Verantwortungsklärung: Wenn nicht klar definiert ist, welche Abteilung für den DPP zuständig ist, droht Verzögerung. Ohne konkrete Zuständigkeiten entsteht „Schiebung“ – niemand fühlt sich zuständig für bestimmte Angaben (etwa Zuliefererdaten oder Umweltauswirkungen). Die Frage nach Zuständigkeiten und Workflows ist deshalb oft die erste Hürde.
- Kosten und Aufwand: Der DPP ist mit erheblichen Kosten verbunden – für IT-Systeme, für Datenerfassung (viele manuelle Recherchen sind nötig) und für Personal. Unternehmen klagen, dass Aufwand und Kosten verhältnismäßig sein müssen, damit DPP-Reporting tatsächlich umgesetzt wird.
- Datenqualität und Vertrauen: Nur korrekte, zuverlässige Daten schaffen Vertrauen bei Behörden und Kunden. Hersteller müssen prüfen, ob die gelieferten Daten tatsächlich belegbar und prüfbar sind. Fehlerhafte oder veraltete Angaben könnten zu Bußgeldern oder Imageschäden führen. Die Qualitätssicherung (stetiges Update der Lebenslauf-Daten) ist daher wichtiger als die reine Datensammlung.
- Datenschutz und Geschäftsgeheimnisse: Manche der im DPP geforderten Informationen können als Geschäftsgeheimnisse gelten (z.B. spezifische Lieferantenketten, exakte Kalkulationsdaten) oder sogar personenbezogene Daten berühren (z.B. Testlabore, wenn Einzelpersonen als Prüfer genannt werden). Hier müssen Hersteller die Balance finden: Sie dürfen notwendige Daten teilen, aber Betriebs- oder Personendaten angemessen schützen. Unsicherheiten in puncto Datenschutz (Stichwort DSGVO) und IP-Rechte sind typische Bremsklötze.
- Rechtliche Unklarheit: Aktuell definiert die EU nur Rahmendaten, viele Details kommen erst in Zukunft. Unternehmen müssen also mit der Ungewissheit leben und sich immer wieder neu informieren. Entsprechende Leitfäden und Austausch mit Branchenverbänden sind deshalb wichtig. Auch wird oft diskutiert, ob kleinere Firmen genug Ressourcen haben, alle Pflichten rechtzeitig zu erfüllen; der Gesetzgeber sieht zwar Unterstützung vor, doch die Umsetzung bleibt für viele eine Herausforderung.
Sie wollen die Übersicht behalten? Dann nutzen Sie unsere kostenlosen Checklisten für die Technische Dokumentation und zur Überprüfung Ihrer Betriebsanleitungen!
Praxisbeispiele aus der Industrie
Ein Beispiel aus dem Verpackungsbereich: Henkel hat für seine Loctite-Kunststoffdose ein Konzept entwickelt. Mit einem QR-Code auf der Verpackung gelangt man zu einem ausführlichen digitalen Produktpass mit Materialzusammensetzung, Umwelt- und Recyclinginfos sowie Anleitungen. Dort sind auch Informationen zu Produktspezifikationen und Umweltauswirkungen wie Kohlenstoffemissionen hinterlegt. Henkel erfüllt dabei auch die Anforderungen der neuen ESPR-Verordnung (Ecodesign for Sustainable Products).
Dieses Beispiel zeigt, dass der DPP praktisch auf serienmäßigen Verpackungen umsetzbar ist.
Umsetzungshinweise für den Digitalen Produktpass
Für die erfolgreiche Einführung des DPP in einem Maschinenbauunternehmen sind folgende Schritte typisch:
- Stakeholder-Analyse: Identifizieren Sie alle internen und externen Akteure, die DPP-Daten liefern oder nutzen. Das sind Lieferanten (für Bauteildaten), Entwicklungs- und Einkaufsteams (für Stücklisten, Materialien), die IT-Abteilung, das Qualitäts- und Umweltmanagement sowie die Technische Redaktion. Extern zählen auch Kunden, Behörden (Marktüberwachung) und Recyclingunternehmen. Binden Sie diese Gruppen früh ein, um ihre Informationsbedürfnisse zu klären.
- Einheitliche Datenbasis schaffen: Legen Sie ein zentrales Datenmodell fest, in dem alle relevanten Produktattribute gespeichert werden. Produktinfos sollten systematisch in bestehende Systeme (PDM/PLM, PIM, MDM) erfasst und über Schnittstellen verknüpft werden. Hersteller verwenden hier oft Stammdatenbanken, Produktinformationssysteme oder dedizierte Nachhaltigkeitssoftware. Wichtig ist dabei eine eindeutige Produktkennzeichnung (z.B. Seriennummer, GUID) und die Nutzung offener Datenaustauschformate (XML/JSON, OPC UA, etc.), wie sie auch in den zukünftigen EU-Standards gefordert werden.
- Prozesse anpassen: Passen Sie Ihre internen Abläufe an: Eine Idee ist, ein „DPP-Board“ oder einen Arbeitskreis einzurichten, der z.B. monatliche Fortschritte überprüft. Führen Sie Checklisten ein (wie „Sind alle Materialdaten vorhanden?“) und Projektpläne für die schrittweise Befüllung des DPP. Beispielsweise kann eine erste Pilotphase für eine Produktlinie oder ein ausgewählter Maschinentyp eingerichtet werden. Evaluieren Sie Erfahrungen: Wo fehlen Daten? Welche Prozesse müssen nachgebessert werden?
- Technische Plattform: Entscheiden Sie, wo der DPP letztlich gespeichert wird. Die EU plant ein zentrales Register, aber bis dahin müssen Lösungen auf Firmen- oder Branchenplattformen greifen. Möglich sind Cloud-Services, die DPP-Daten hosten. In vielen Fällen macht es Sinn, existierende Infrastruktur zu nutzen: So kann z.B. ein PIM-System oder PLM-System um DPP-Module ergänzt werden. Auch Digital-Twin-Plattformen oder offene Protokolle kommen infrage. Wichtig ist, dass die Plattform offene Standards unterstützt und Zugriffsrechte sauber regelt.
- Dokumentation und Automatisierung: Technische Redakteure sollten früh überlegen, wie ihre Inhalte ins DPP gelangen. Eine Möglichkeit wäre Inhalte (etwa aus Anleitungen) frühzeitig mit Metadaten zu versehen, so dass sie direkt im DPP verlinkt werden können. Selbstverständlich muss weiterhin eine klassische Ausgabe (wie PDF, HTML) möglich sein – aber parallel entsteht die „Datenbank-Maschine“. Automatisierungstools (z.B. Scripts, XML-Publishing) sind ratsam, um Routineaufgaben (z.B. das Extrahieren von Teilenummern und Materiallisten) zu erleichtern.
- Schulung und Kommunikation: Schulen Sie Ihre Redaktion und Ingenieure für die neuen Anforderungen. Oft hilft es, Best-Practice-Beispiele zu zeigen und einen Pilotworkflow zu erproben. Legen Sie außerdem fest, wie Sie künftig mit Kunden und Marktüberwachung kommunizieren: Etwa durch QR-Codes auf der Maschine oder einen Zugriff über Online-Services, die den DPP freigeben.
- Kontinuierliche Verbesserung: Etablieren Sie einen Prozess, um den DPP regelmäßig zu pflegen: Schon nach kleinen Produktänderungen (z.B. neue Baugruppen) muss der Pass aktualisiert werden. Interne Audits oder Zertifizierungen nach neuen Umwelt-Normen können helfen, die Datenqualität zu überprüfen. So werden die DPP-Daten ständig verbessert und bleiben vertrauenswürdig.
Fazit
Der Digitale Produktpass stellt Maschinenbauer vor eine umfassende Umstellung – von den Entwicklungs- und Produktionsprozessen bis hin zur Dokumentation. Er bietet aber auch Chancen: Wer früh eine einheitliche Datenbasis schafft, kann die Servicedienstleistungen am Produkt verbessern und seine Maschinen als nachhaltig ausweisen. Ein narrativer Ansatz – etwa indem man den DPP als „Lebenslauf“ des Produkts begreift – hilft, beteiligte Bereiche zu vernetzen. Wichtig ist, jetzt gemeinsam mit IT, Entwicklung und Zulieferern zu starten, bevor die Gesetzgebung wirklich zur Pflicht wird. Auf diese Weise können Maschinenbauer die Herausforderung DPP in eine langfristige Ressource verwandeln.