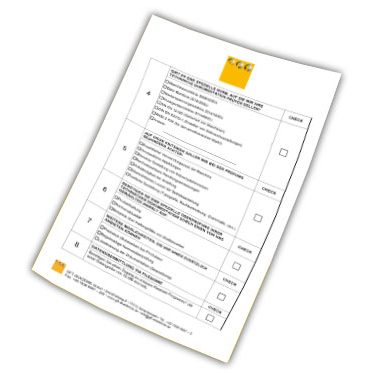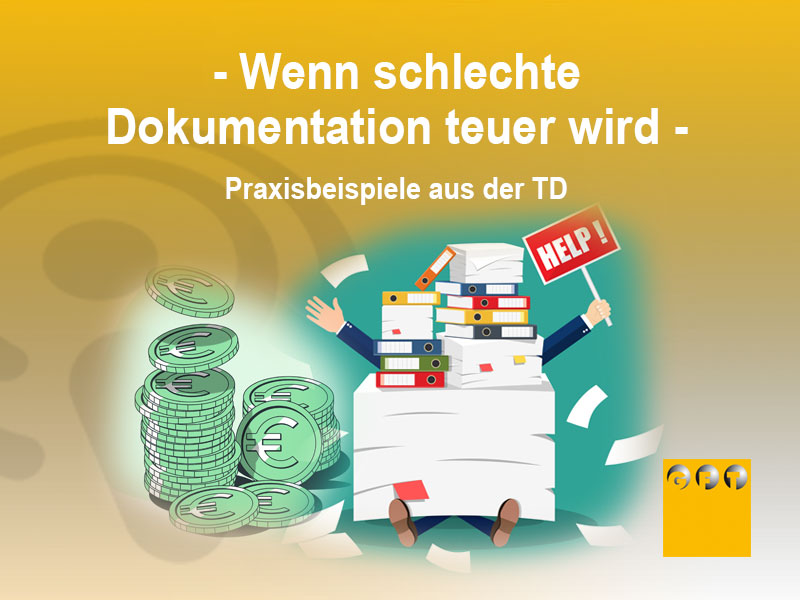Eine Automatisierung der Technischen Dokumentation klingt ein bisschen wie Wunschdenken. In vielen Maschinenbauunternehmen läuft es…
VS #005 Mangelhafte Übersetzungen: Haftungsrisiken in der Technischen Dokumentation

Heute geht es um ein Thema, das bei vielen Unternehmen einen noch schlechteren Stellenwert hat, als die Betriebsanleitung. Es geht um die Übersetzung von Dokumenten in Fremdsprachen und wie der Fokus auf möglichst günstige Preise die Qualität der Übersetzungen untergraben kann. Dazu schauen wir uns heute markante Praxisbeispiele an, in denen mangelhafte Übersetzungen zu enormen finanziellen Verlusten und rechtlichen Problemen führten. Ihre Ursachen sind verblüffend banal – die Auswirkungen dagegen umso gewaltiger.
Viele Unternehmen sehen Übersetzungsaufträge als unbedeutende Pflichtaufgabe an – doch schon ein einziger Fehler kann massive Folgen haben. Mangelhafte Übersetzungen führen nicht nur zu Missverständnissen, sie können Menschenleben gefährden, Unternehmen ruinieren und zu satten Schadenersatzforderungen führen.
Beginnen wir direkt mit einem ersten Fallbeispiel aus der Praxis. Danach schauen wir uns die rechtlichen Rahmenbedingungen an, besprechen die Konsequenzen für Hersteller und geben Ihnen praktische Tipps, wie Sie solche Probleme vermeiden.
Praxisbeispiel 1 – Wenn der Name zum Fettnäpfchen wird
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an der internationalen Markteinführung eines neuen Produkts – der Name ist markant, eingängig und perfekt fürs Branding. Doch kaum landet das Fahrzeug in Spanien oder der Kleinwagen in Brasilien, entpuppt sich der vermeintliche Verkaufshit als peinlicher Flop. Solche kulturellen Tretminen passieren schneller, als man denkt, und zeigen eindrücklich: Self-service-Recherchen à la Google Translate reichen bei Markennamen nicht aus.
Mitsubishi Pajero → Montero
Ein Klassiker unter den Übersetzungspannen ist der Geländewagen von Mitsubishi. Für uns Deutsche klingt „Pajero“ völlig harmlos – vielleicht exotisch, aber unbedenklich. In Spanien allerdings bedeutet „pajero“ nichts anderes als „Wichser“. Kein besonders ansprechender Name für eine robusten Offroader. Mitsubishi erfuhr das auf die harte Tour und verkaufte die Modelle in Spanien kurzerhand unter dem neuen Namen „Montero“ – zu Deutsch „Jäger“. Eine einfache, aber wirksame Lösung, um den kulturellen Fauxpas wettzumachen.
Ford Pinto in Brasilien
In den 1970er-Jahren brachte Ford den Kleinwagen „Pinto“ auf den lateinamerikanischen Markt. In Brasilien sorgte das jedoch eher für Gelächter als für Kaufinteresse, denn „pinto“ ist umgangssprachlich das Wort für „Pimmel“. Das Ergebnis: Der „Pino“ verkaufte sich nur schleppend, weil niemand seinen Intimteil am Auto sehen wollte. Hinter dieser Panne steckt wohl ein Name-only-Check ohne Muttersprachler-Review – ein Fehler, den sich heute kein Marketing-Team mehr leisten wollte.
Toyota MR2 und die französische “Merde”
Noch subtiler ist das Beispiel des Sportcoupés Toyota MR2. Schnell ausgesprochen klingt „M-R-zwei“ im französischen Ohr fast wie “merde” – zu Deutsch „Scheiße“. Kein Wunder, dass Toyota in Frankreich auf die Modellbezeichnung verzichtete und stattdessen mit alternativen Buchstabenvarianten arbeitete. Diese Episode zeigt: Selbst Zahlen-Buchstaben-Kombinationen können in einer anderen Sprache plötzlich unangemessene Assoziationen auslösen.
Übergang zu wirtschaftlichen Folgen
Solche kulturellen Namensfehler wirken zwar witzig sind aber keineswegs harmlos. Sie kosten Zeit, Geld und Reputation – und im schlimmsten Fall werden Werbekampagnen zurückgezogen oder Modelle gar nicht erst ausgeliefert. Spätestens hier wird klar: Ein Name ist mehr als ein Label, er ist Teil Ihrer Produkt-Dokumentation und Ihres Markenschutzes. Sprachen und Kulturen sollte man daher niemals unterschätzen.
Praxisbeispiel 2 - Verwechslung von Gas und Bremse im Fahrzeughandbuch
Unser nächstes Beispiel wird etwas ernster. Es ist jedoch rein fiktiv, kam also so in der Wirklichkeit nicht vor. Jedoch fließt in dieses Beispiel viel Berufserfahrung aus meiner beruflichen Vergangenheit ein, weshalb es durchaus so eintreten könnte. Es ist eine Sammlung der verschiedensten Fehler, die im Übersetzungsbereich auftreten können. Wer sich beruflich mit Übersetzungen beschäftigt hat, wird mir sicherlich zustimmen.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Projektleiter bei einem großen Automobilhersteller. Ein wichtiger Exportauftrag verlangt, dass eine komplette Modellreihe innerhalb von nur zwei Wochen nach Portugal geliefert wird. Wegen des engen Zeitplans und hohem Kostendruck aus dem Einkauf wird beim Übersetzer kein großer Aufwand einkalkuliert. Der günstigste Anbieter, der nur 0,65 € pro Zeile verlangt, bekommt den Auftrag – inklusive der Handbücher mit bebilderten Bedienungsanleitungen.
Muster-Betriebsanleitungen, Vorlagen für Warnhinweise, sowie Checklisten, E-Books und vieles mehr. Besuchen Sie jetzt unseren Online-Shop für die Technische Dokumentation!
Der folgenschwere Zahlendreher
In den bebilderten Handbuchseiten waren die Symbole für „Gaspedal“ und „Bremspedal“ jeweils mit Nummern versehen: „1“ für Gas, „2“ für Bremse. Der Übersetzer, der das Bildlayout nicht vollständig verstanden hatte und nachts unter Termindruck arbeitete, vertauschte in seinem Programm die Bildbeschriftungen – Nummer 1 wurde unter das Bremspedal gesetzt, Nummer 2 unter das Gaspedal. Dieses einfache Vertauschen von zwei Nummern in den Texten reichte aus, um aus einer harmlosen Anleitung eine tödliche Fehlanweisung zu machen.
Konsequenzen in Portugal
Kaum waren die Fahrzeuge in Portugal ausgeliefert, kam es zu ersten Unfällen, weil die Fahrer sich strikt an die bebilderte Anleitung hielten. In drei Fällen endete die Verwechslung von Gas und Bremse in schweren Kollisionen; fünf Familien verloren dabei Angehörige. Das ist natürlich rein fiktiv, aber ein Albtraum für jeden Technischen Redakteur und Übersetzer – und ein Worst-Case-Szenario für das Risikomanagement des Herstellers.
Planung und Preisdruck als Fehlerquelle
Was lief hier schief? Zunächst war die Projektplanung fehlerhaft: Die Zeitfenster für Übersetzung, Layout und Review waren unrealistisch knapp. Ein echtes Vier-Augen-Prinzip zur Überprüfung der Bilder und Texte fand nicht statt. Dann der entscheidende Fehler im Einkauf: Statt auf Qualität und Zertifizierung (z. B. DIN EN ISO 17100) zu achten, entschied man sich für den billigsten Anbieter. Unter diesem Kostendruck konnten weder ausreichend Ressourcen noch Muttersprachler-Reviews eingeplant werden.
Haftungsfragen bei Übersetzungsfehlern
Wer würde nun haften? Rechtsanwälte argumentieren, dass in einem solchen Produkthaftungsfall alle Beteiligten – der Hersteller, das Übersetzungsbüro und der verantwortliche Projektmanager – in die Verantwortung genommen werden können.
Haftung der Hersteller
Viele Hersteller gehen fälschlicherweise davon aus, dass sie durch eine eindeutige Kennzeichnung wie „Originalanleitung“ und „Übersetzung der Originalanleitung“ jede Verantwortung auf den Übersetzer oder das Übersetzungsbüro abwälzen können. Das ist jedoch ein Irrtum. Selbst wenn Sie einen externen Übersetzer beauftragen, bleibt das Produkt letztlich Ihr Produkt.
Als Inverkehrbringer eines Produkts haften Sie gemäß Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) und EU-Produkthaftungsrichtlinie für alle Schäden, die durch Fehler in der Gebrauchsanleitung entstehen – unabhängig davon, ob die Anleitung übersetzt wurde oder nicht. Die Kennzeichnung „Übersetzung der Originalanleitung“ entbindet Sie also nicht von der Pflicht, die Vollständigkeit und Richtigkeit jeder Sprachfassung sicherzustellen.
Die deutschen Gerichte haben mehrfach klargestellt, dass die Pflicht zur Bereitstellung verständlicher Anweisungen nicht delegierbar ist. Kommt es zu Unfällen, prüfen Gerichte genau, ob der Hersteller den Übersetzungsprozess in seine Qualitätssicherung integriert hat. Wurde die Übersetzung etwa nicht gegen das Original geprüft oder entfielen Freigaberunden, spricht dies für eine Verletzung der Sorgfaltspflicht. In solchen Fällen führt dies zu einer Herstellerhaftung, auch wenn ein externer Dienstleister formal beauftragt wurde.
Zentrale Grundlagen dafür ist das Urteil des Oberlandesgerichts München vom 14. Juni 2007 (Az. 6 U 4082/05). Rechtlich untermauert wird das ganze durch § 434 Absatz. 1 Satz. 2 Nr. 2 BGB („fehlerhafte Anleitung“ als Sachmangel) sowie durch § 1 ProdHaftG, wonach Hersteller für Fehler in der Gebrauchsanleitung haften – egal ob sie selbst oder ein Dienstleister sie erstellt haben.
Haftung des Übersetzungsbüros bzw. des Übersetzers
Auch der Übersetzer oder das Übersetzungsbüro können haftbar gemacht werden. Übersetzer schulden laut BGB (§ 631 ff.) eine „erfolgsgarantierte“ Leistung – ihre Arbeit muss inhaltlich korrekt und fachgerecht sein. Übersetzer, die grob fahrlässig oder vorsätzlich falsche Textteile liefern, haften persönlich für daraus entstehende Schäden.
Viele Agenturen versuchen, ihre Haftung in den AGB zu begrenzen, indem sie leichte Fahrlässigkeit ausschließen, ihre maximale Haftung auf das Honorar deckeln oder sehr kurze Prüfzeiten für die Übersetzungen ansetzen. Doch im Zusammenspiel mit der EU-Produkthaftungsregelung sind solche Beschränkungen oft unwirksam, wenn die fehlerhafte Übersetzung als Teil der Produktdokumentation gilt. Wurde die Übersetzung durch einen einzelnen Freelancer erstellt, stellt sich hier die Frage: Wie gut ist der Freelancer versichert und wäre hier überhaupt eine Entschädigungszahlung möglich?
Haftung der Projektmanager
Schließlich können auch Projektmanager oder Einkäufer haften, wenn sie durch unzureichende Planung und Billigentscheidungen den Fehler verursachen. Wird der Übersetzungsprozess ohne ausreichende Zeitpuffer, fachliche Reviews oder vier Augen–Prinzip angelegt, verletzt dies die organisatorische Sorgfaltspflicht.
In einem Schadenfall könnte ein Gericht entscheiden, dass der Projektmanager als Verantwortlicher für das Prozessdesign mit in die Haftung genommen wird.
Fazit zur Haftung
Eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung im Übersetzungsprozess ist unerlässlich. Hersteller, Übersetzer und Projektmanager müssen gemeinsam dafür sorgen, dass jede Sprachversion fehlerfrei, geprüft und freigegeben ist – sonst haften am Ende alle Beteiligten.
Sie wollen die Übersicht behalten? Dann nutzen Sie unsere kostenlosen Checklisten für die Technische Dokumentation und zur Überprüfung Ihrer Betriebsanleitungen!
Praxisbeispiel 3 – Fehlende Anleitung im Ausland
Im dritten Beispiel geht es um einen Maschinenbauer, der eine Maschine ins Ausland – nach Italien – verkauft. Im Angebot des Maschinenbauers ist die Übersetzung ins Italienische für die HMI-Steuerung und die Anleitung als optionale Position aufgeführt.
Der Kunde bestellt das Angebot, jedoch ohne die optionale Positionen. Die Maschine wird mit Deutsch und Englisch ausgeliefert, der Maschinenbauer wähnt sich auf der rechtssicheren Seite.
Und bei Übergabe fordert der Kunde nun die italienische Steuerung und die italienische Betriebsanleitung, die Dokumente in Landessprache. Und erhöht den Druck durch die Einschaltung eines Anwalts und durch das zurückhaltens eines Teils des Kaufpreises.
Bis zur Lieferung der Übersetzung behält der Kunde 5% des Kaufpreises zurück. Wir reden in diesem Fall von einem Auftragswert von 2 Millionen Euro, also eine Rückbehalt von 100.000 EUR. 100.000 EUR die solange nicht fließen, bis alle Dokumente (inklusive korrekter Übersetzung) vorliegen.
Rechtliche Analyse des Falls
Warum ist das überhaupt möglich? Nun fangen wir ganz vorne, beim Kaufvertrag und der optionalen Deklaration der Übersetzung. Eine Kennzeichnung im Angebot („optional: Übersetzung ins Italienische“) ändert nichts an der zwingenden Rechtslage. Das EU-Recht verlangt zwingend eine italienische Sprachfassung. Diese Vorgabe ist in jedem Mitgliedsstaat der EU unmittelbar in nationales Recht umgesetzt worden und hat Vorrang vor abweichenden vertraglichen Vereinbarungen. Fehlen sprachliche Fassungen, gilt die Maschine dadurch als mangelhaft, auch wenn sie technisch einwandfrei arbeitet.
Im EU-Recht ist diese Anforderung als Teil der CE-Konformität verankert. In der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG steht dies unter Anhang I, Nummer 1.7.4: „jeder Maschine eine Betriebsanleitung in der oder den Amtssprachen des Mitgliedstaats beiliegen, in dem die Maschine in Verkehr gebracht wird“. Ähnliche Formulierungen gibt es in jeder CE-Richtlinie.
Diese Anforderung gibt es so übrigens nicht nur in der EU. Auch im Ausland gibt es Regelungen die eine Übersetzung in Landessprache fordern. Fehlt diese Übersetzung, kann das behördliche Konsequenzen haben: Das Produkt wird vom Zoll so lange zurückgehalten, bis sämtliche Unterlagen in der Landessprache vorhanden sind.
Haben Sie den geforderten Sprachumfang nicht vollständig beachtet, kann das also auch Lieferfristen verzögern und sogar Vertragsstrafen auslösen. Solche Szenarien zeigen: Übersetzungen sind kein „Nice to have“. Für die CE-Kennzeichnung und den freien Handel auf dem Weltmarkt ist die mehrsprachige Dokumentation zwingend erforderlich.
Praxisbeispiele Teil 4 – Wenn Nuancen Millionen Dollar kosten
Kommen wir zu unseren letzten Beispielen. Wir haben nun fehlerhafte Texte, vollständig fehlende Übersetzungen und kulturelle Eigenheiten besprochen. Fehlen also noch die kleinen, unscheinbaren Fehler. Diese treten häufig in Texten für die Öffentlichkeit auf, wo es um Nuancen und Formulierungen geht. Marketingtexte und Geschäftsberichte sind hier gute Beispiele.
Unser Beispiel stammt aus dem Jahr 2012 und betrifft den japanischen Elektronikkonzern Sharp. Denn auch in der Wirtschaft kann ein einziger falsch verstandener Satz teuer werden: Sharp meldete in seinem Ergebnisbericht einen Quartalsverlust, ohne seine Aktionäre beunruhigen zu wollen. Bei der Übersetzung der Pressemitteilung ins Englische unterlief jedoch ein drastischer Fehler: Ein im japanischen eigentlich beruhigend wirkender Satz wurde so übersetzt, dass plötzlich das Management erhebliche Zweifel an der Zukunft des Unternehmens verkündete. Die englische Formulierung war deutlich düsterer als die japanische Originalaussage. Die Folge: Anleger gerieten in Panik, Sharps Aktienkurs stürzte um etwa zehn Prozent ab. Erst Tage später korrigierte Sharp die Fassung; den initialen Schock konnte das Unternehmen aber nicht mehr rückgängig machen. Der Schaden war bereits angerichtet.
Aber nicht nur in der schriftlichen Übersetzung können Nuancen eine große Wirkung haben, sondern auch im gesprochenen Wort. Wir wechseln also noch zum Schluss kurz zum Dolmetschen.
Unser dortiges Beispiel spielte in den 1980er Jahren. Der 18-jährige Willie Ramirez wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem seine Familie im Spanischen berichtet hatte, er sei “intoxicado” – also vergiftet durch etwas, das er gegessen hatte. Der Dolmetscher übersetzte dieses Wort jedoch fälschlich mit “intoxicated”, also berauscht. Die Ärzte behandelten Ramirez daraufhin wegen einer vermeintlichen Drogenüberdosis, während er in Wahrheit an einer Gehirnblutung litt. Der Junge wurde schließlich querschnittsgelähmt – ein einziger Übersetzungsfehler mit dramatischem Ausgang. Das Krankenhaus bezahlte knapp 71 Millionen Dollar Schadenersatz. Eine winzige sprachliche Panne mit enormen Folgen.
Folgen von mangelhaften Übersetzungen
All diese Beispiele und Fälle zeigen gravierdene Folgen für mangelhafte Übersetzungen. Diese können sich in den verschiedensten Ebenen zeigen:
- Negative Auswirkungen auf den Versicherungsschutz: Berufshaftpflicht- und Produkthaftpflichtversicherungen prüfen bei Schäden, ob die Dokumentation dem Stand der Technik entspricht. Ist die Anleitung (übersetzt oder nicht) lückenhaft, können Versicherungen die Leistung verweigern oder Kürzungen vornehmen. Achten Sie also auch darauf, dass Ihre Versicherungen im Schadensfall Deckung bieten – das setzt saubere Übersetzungen und eine vollständige Dokumentation voraus.
- Finanzielle Risiken: Wie in unserem Beispiel gezeigt, können erhebliche Teile des Kaufpreises zurückbehalten werden, falls die Übersetzungen fehlen. Hinzu kommen mögliche Schadensersatzansprüche, Vertragsstrafen und Verzugszinsen, wenn Auslieferungen verzögert werden. Solche Kosten können die Liquidität und Rentabilität eines Projekts empfindlich beeinträchtigen.
- Reputation und Kundenvertrauen: Nicht zuletzt führt eine unklare oder fehlende Übersetzung zu einem Vertrauensverlust beim Kunden. Eine mangelhafte Anleitung lässt ihn am ganzen Produkt zweifeln. Auch wenn Sie technisch einwandfrei bauen, zweifelt der Kunde womöglich an Ihrer Sorgfalt. Das gefährdet Folgeaufträge und Ihre Marktposition. Gerade in internationalen Märkten erwarten Kunden professionelle Dokumente in ihrer Sprache.
- Marktzulassung und Zoll: Wie erwähnt kann ein fehlendes CE-Dokument oder mangelnde Übersetzung sogar an der Grenze zu Problemen führen. Besonders bei Exporten in Nicht-EU-Länder sind Zollkontrollen strenger, und fehlende Übersetzungen können Einfuhr verzögern oder sogar verhindern. In einigen Branchen (etwa Medizintechnik) kann schon ein kleiner Dokumentationsfehler zum Rückruf oder Marktverbot führen.
All das zeigt: Finanzielle Risiken durch schlechte Übersetzungen sind enorm. Die Auswahl der günstigsten Anbieter zur Kosteneinsparung kann sich durch Nachlässigkeit sich schnell bitter auszahlen.
Praxis-Tipps
Daher habe ich Ihnen nun zum Schluss noch ein paar Praxis-Tipps. Damit Sie sicher durch das Minenfeld der schlechten Übersetzungen navigieren können.
- Übersetzungen frühzeitig einplanen: Beziehen Sie den Übersetzungsprozess von Anfang an in Ihre Projektplanung mit ein. Warten Sie nicht auf die letzte Minute, wenn bereits die Auslieferung droht. Planen Sie Puffer für Übersetzung, Prüfung und Korrektur ein. So vermeiden Sie teure Last-Minute-Nachträge oder Verzögerungen.
- Fachübersetzer und Experten einsetzen: Ziehen Sie qualifizierte Übersetzungsdienstleister hinzu, idealerweise nach DIN EN ISO 17100 zertifiziert. Diese Standardnorm fordert beispielsweise einen Vier-Augen-Prozess, bei dem ein zweiter Übersetzer Korrektur liest. Das verhindert einfache Fehler wie Begriffstausch oder falsche Einheiten. Lassen Sie besonders sicherheitsrelevante Passagen von Fachpersonal (oder Muttersprachlern) validieren. Wie der Automobilfall zeigt: Billiganbieter, etwa mit 0,65 € pro Zeile, bringen meistens unzureichende Qualität. Achten Sie also auf Qualifikation statt nur auf Preis.
- CE- und Rechtsvorgaben beachten: Informieren Sie sich über die länderspezifischen Vorgaben. Für Maschinen schreibt die CE-Maschinenrichtlinie vor, dass jede Anleitung in den Amtssprachen des Bestimmungslandes vorliegen muss. Übersetzungsanforderungen sind also keine Kür. Planen Sie von vornherein alle benötigten Sprachen ein und halten Sie sich an Normen wie DIN EN ISO 17100.
- Verträge und Haftung klären: Prüfen Sie die AGB Ihrer Übersetzer auf Haftungsausschlüsse. EU-Recht macht weite Haftungsausschlüsse oft unwirksam. Klären Sie stattdessen vertraglich, wer für Fehler haftet und bis zu welcher Höhe. Denken Sie auch an Ihre Produkthaftpflichtversicherung: Stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen an die Dokumentation erfüllen, damit der Versicherer im Ernstfall leistet.
- Kontinuierliche Qualitätskontrolle: Nutzen Sie Tools wie Translation Memory und Terminologiedatenbanken, um Übersetzungs-Konsistenz zu gewährleisten. Überarbeiten und aktualisieren Sie Übersetzungen parallel zu Änderungen am Originaltext. Führen Sie regelmäßig Reviews durch, am besten durch Fachredakteure in der Zielsprache. So bleiben Ihre Anleitungen stets aktuell und verständlich.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen: Mangelhafte Übersetzungen sind in technischer Dokumentation mehr als nur ein kleines Ärgernis – sie gelten rechtlich als Produktmangel und können Kosten in Millionenhöhe verursachen. Fehlt die Anleitung in der Landessprache oder ist sie fehlerhaft, drohen Zahlungseinbehalte, Vertragsstrafen und in schweren Fällen Produkthaftungsansprüche. Versicherungen können die Deckung bei Dokumentationsmängeln verweigern. Das Ziel muss deshalb lauten: Vermeiden Sie Übersetzungsfehler von Anfang an.
Es lohnt sich daher nicht zu sparen, wenn es auf Präzision ankommt: Wer am Anfang in qualifizierte Übersetzungen, gründliche Terminologie- und Qualitätsprüfungen sowie in penible Dokumentation investiert, zahlt langfristig weniger. Jede übersetzte Seite und jedes Protokoll sind eine Versicherung gegen teure Haftungsforderungen. Unternehmen sollten deshalb nicht den billigsten Anbieter wählen: Eine professionelle Übersetzung kostet zwar mehr, ist aber um ein Vielfaches günstiger als ein verlorener Rechtsstreit oder ein öffentlicher Rückruf. Qualität und Transparenz von Anfang an sind günstiger als die Folgekosten später.